Nockenwellen 16v
-
-
-
#2 hi, hilft dir das schon mal weiter? was besseres hab ich auf die schnelle nicht gefunden und selber schreiben dauert mir jetzt zu lange:
Zunächst müssen wir also den exakten OT finden. Dazu benötigt man eine Gradscheibe , eine Höhenmessuhr und einen Draht als Zeiger. Wenn man nun die höchste Stellung eines Kolbens per Messuhr einmessen könnte wäre es einfach. Im höchsten Punkt aber, wenn der Kolben wieder auf den Weg nach unten möchte, scheint der Kolben laut Messuhr für ein paar Grade stillzustehen. Der exakt höchste Punkt ist weder zu sehen noch, zu messen. Also werden wir ihn errechnen. Ganz einfach: Die Gradscheibe wird auf der Kurbelwelle befestigt, der Draht als Zeiger am Block und die Uhr kommt mit dem Magnetfuß auf den Block. Nun wird die Kurbelwelle gedreht bis der Kolben knapp unter der höchsten Stellung ist. Jetzt wird der Fühler der Messuhr aufgesetzt. Dreht man die Kurbelwelle nun weiter, so wird man einen Punkt erreichen an dem der Zeiger nicht mehr steigt. Diesen Anzeigepunkt auf der Uhr merken wir uns. Nun drehen wir die Kurbelwelle zurück, bis der Zeiger z.B. 30 Teilstriche auf der Uhr u n t e r dem höchsten Wert angekommen ist. Da der Zeiger in Bewegung war, kann das auf der Gradscheibe exakt nur ein bestimmter Wert sein, der exakt zu diesem Zeitpunkt vom Draht (Zeiger) angezeigt wird. Diese Gradzahl notieren wir uns. Nun drehen wir die Kurbelwelle wieder vorwärts in Richtung ansteigender Kolben bis der Kolben seinen höchsten Punkt überschreitet und wieder fällt Gleichzeitig fällt damit auch der Zeiger auf der Uhr- Wir drehen jetzt solange, bis der Zeiger exakt wieder 30 Teilstriche unter unserem höchsten Wert anzeigt. Die dabei an der Gradscheibe auftretende Gradzahl notieren wir uns ebenfalls. So, und nun ist es einfach: Der höchste Punkt OT muß exakt in der Mitte zwischen diesen beiden Gradzahlen liegen, für welche wir einen Wert von '30 Teilstriche unter' ermittelt hatten.Genau auf diesen Mittelwert drehen wir die Kurbelwelle, richten die Gradscheibe so ein, daß sie jetzt Null zeigt und haben unseren OT ermittelt
Beim Ermitteln des höchsten Nockenpunktes erleben wir das gleiche Phänomen wie bei der Kurbelwelle. Also müssen wir wieder rechnen. Die Messuhr kommt auf den Stössel des Einlassventils 1. Zylinder. Im gleichen Verfahren wie bei der Kurbelwelle wird nun ermittelt, wo das Einlassventil seinen vollen Hub hat und damit voll öffnet. Das Ergebnis zeigt Im Vergleich mit der Beilage zur Nockenwelle um wieviel dieser Istwert vom Soll abweicht. Diese Abweichung kann nun auf mehreren Wegen bereingt werden. 1.Mittels eines aussermittig geschliffenen Versatzkeiles wird das Rad eingerichtet und korrigiert. 2. Durch verstellbare Nockenwellenräder wird der Versatz solange korrigiert bis es stimmt. Die Bedeutung dieser Korrektur ist dabei nicht zu unterschätzen ! 1° Versatz kann leicht 1 PS Leistungsverlust bedeuten. Für einen Sportmotor, dem zuvor mit viel Mühe Leistung vermittelt werden sollte, sind dann 3° eine Menge! Sollten Sie nicht beim 1 Versuch mit entweder Einmessen oder Einstellen zum Erfolg kommen, so sein Sie versichert, daß jeder üben mußte.
Benötigte teile:
2x messuhr mit magnetischen halter
gradscheibe
klebeband
draht
datenblatt von der nockenwelle
werkzeug
stift und blockoder noch etwas mi bild:
Ein wirklich lohnender Bereich für den Tuner. Die Wahl der Steuerzeiten bestimmt ganz wesentlich den Charakter eines Motors. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, daß ein Motor um die Steuerzeiten herum gebaut wird.
Selbst mit den Seriennockenwellen läßt sich über ein genaues Einstellen der Steuerzeiten oft einiges an Leistung finden. Schon geringe Abweichungen vom Optimum bewirken einen weit unter seinen Möglichkeiten laufenden Motor. Eine verschlissene Steuerkette, verschlissene Gleitschienen oder un- genau gefertigte Bohrungen in den Kettenrädern führen dazu, daß ein Motor nur selten exakt eingestellte Steuerzeiten hat. Ein Versatz um nur 2,5° an der Nockenwelle bedeutet 5° Kurbelwelle und eine Leistungskurve, die deutlich schlechter verläuft als mit korrekten Steuerzeiten.
Über den theoretischen Hintergrund dieser Maßnahmen gibt es sehr viele gute Bücher (ich empfehle zu diesem Thema gerne Ludwig Apfelbecks "Wege zum Hochleistungs-Viertaktmotor" ), die sich über zig Seiten damit beschäftigen. Da ich hier eine praktische Anleitung geben und mir mit meinen zwei Fingern keinen Wolf schreiben will, beschränke ich mich auf wenige Punkte.
Einstellen SteuerzeitenDas Einlaßventil muß, da es sich nicht beliebig schnell öffnen läßt, schon vor dem OT öffnen, um zum Beginn des Ansaugvorganges einen ausreichend großen Querschnitt freizugeben.
Die Ansaugsysteme sind schwingungstechnisch so ausgelegt, daß zu diesem Zeitpunkt eine Druckwelle im Ansaugtrakt den Beginn der Füllung unterstützt. Das ist notwendig, weil der Kolben hier noch sehr langsam ist und keinen wirksamen Unterdruck aufbaut. Je nach Pleuellänge erreicht der Kolben schon kurze Zeit später, nämlich deutlich vor 90° nach UT (je kürzer das Pleuel im Verhältnis zum Hub, umso früher), seine maximale Geschwindigkeit und die Gassäule würde sonst stark hinterherhinken.
Wenn der Kolben dann den UT erreicht, hat die Gassäule im Ansaugkanal bei hohen Drehzahlen noch soviel Bewegungsenergie, daß sie gegen die beginnende Aufwärtsbewegung des Kolben weiter Gemisch in den Brennraum drückt. Erst wenn diese beiden Effekte sich aufheben, sollte das Einlaßventil schließen. Bei niedrigen Drehzahlen und einer langsamen Gassäule bedeutet das natürlich, daß ein Teil des Gemischs wieder in den Ansaugtrakt zurückgedrückt wird und die Leistung sinkt. (Das ist der wesentliche Grund, aus dem Motoren mit scharfen Steuerzeiten bei niedrigen Drehzahlen so schlapp laufen.) Die Gassäule hat aber immer noch eine gewisse Energie, wenn sie auf das inzwischen geschlossene Einlaßventil trifft. Dieser Impuls wird ein reflektiert und im günstigen Fall (Drehzahlbereich) wieder als Druckwelle auf das sich öffnende Einlaßventil stoßen.
Der Auslaßbeginn muß vor UT liegen, um die Abgase, die ja unter Druck stehen, rechtzeitig in den Auslaß strömen zu lassen, damit der Kolben in seiner Aufwärtsbewegung nicht gegen einen Überdruck arbeiten muß. Das Auslassventil ist aber beim Erreichen des OTs noch geöffnet, weil die Strömung des Abgases so den Beginn des Ansaugvorgangs unterstützen kann. (Nur durch diesen Effekt sind Füllungen über 100% überhaupt möglich). Auch diese Werte sind immer ein Kompromiss, der bei niedrigen Drehzahlen einen Teil der Energie verschenkt. Wichtig bei diesen Vorgängen ist auch die gute Spülung des Brennraums von verbrannten Gasen. Der Kolben kann mit seiner Aufwärtsbewegung nur den Hubraum leeren. Ohne die Überschneidung der Steuerzeiten würde ein Teil der Füllung aus praktisch sauerstofflosem Abgas bestehen.
Kurze Zusammenfassung:
Am wichtigsten ist er Einlaßschluß, aber er muß mit vielen anderen Faktoren harmonieren. Ein späterer Einlaßschluß verschiebt die maximale Leistung in höhere Drehzahlbereiche und verringert die Leistung bei niedrigen Drehzahlen. Ein früherer sorgt dafür, daß der Motor "Drehmoment" hat. Passend dazu muß der Auslassbeginn liegen. Bei den meisten Motoren sind die Steuerzeiten symmetrisch oder annähernd symmetrisch.
Z.B:
Auslaß öffnet 60° vor UT schließt 30° nach OT
Einlaß öffnet 30° vor OT schließt 60° nach UT
D. h. , daß Einlaß und Auslaß gleichlang geöffnet sind (270°) und die Kurven sich im OT überschneidenMan trifft aber nicht selten auf unsymmetrische Nockenwellen, bei denen die Auslaßöffnung etwas kürzer ist als die Einlaßöffnung. Hier sollte die Überschneidung vor OT erfolgen. Bei Nocken, deren Auslaß-öffnung länger ist, entsprechend nach OT.
Bei diesen unsymmetrischen Nocken solltest du dich eher an Auslaßbeginn und Einlaßschluß orientieren. Für die Grundeinstellung sollten diese beiden Werte gleich hoch, bzw. etwas nach vorne verschoben sein.
In der Literatur finden sich unterschiedliche Angaben zum Thema maximal später Einlaßschluß. Die meisten Autoren haben sich auf 60-65° geeinigt. Dieser Wert ist bezogen auf 1mm Ventilhub. Leider gibt es bei den Angaben zu den Steuerzeiten für den gleichen Nocken sehr unterschiedliche Werte. Die einen beziehen sich auf die Öffnung ab Ventilspiel, andere auf 0,5 oder 1mm Ventilhub. Dadurch ergeben sich für gleiche Nocken erheblich unterschiedliche Angaben. So kann es leicht passieren, daß eine "320°-Nocke", bei 1mm Ventilöffnung gemessen, auf realistischere 270° zusammenschnurrt. Und selbst die wäre schon ein ganz schön scharfes Teil. Wenn du eine andere Nockenwelle einbauen willst, erkundige dich, auf welches Maß sich die Gradangaben beziehen. Oder laß dir ein Diagramm der Steuerzeiten geben, damit du sie mit den Werten der Originalnocke vergleichen kannst.
Jetzt zum praktischen Teil:
Mit einer Gradscheibe und einer Meßuhr ermittelst du zuerst den genauen OT. Verlaß dich nie auf die OT-Markierung auf der Kurbelwelle. Hier zählt wirklich jedes einzelne Grad. Dann nimmst du mit der Meßuhr alle 5° die Öffnung der Ventile ab. Diese Werte lassen sich auf Millimeterpapier gut und aussagekräftig eintragen und verbinden. Bei dieser Messung muß die Kurbelwelle immer in Betriebsrichtung gedreht werden.
Ein ganz wesentlicher Punkt ist der Überschneidungspunkt der Ventilkurven, d.h. die gleiche Öffnung von Ein- und Auslaßventil. Dieser sollte bei symmetrischen Nocken kurz vor oder im OT liegen. In hoch drehenden Motoren mit elastischen Ventiltrieben etwas weiter (max. 5°) davor. In OHV-Motoren mit langen Stößelstangen ausnahmsweise auch mal bis 10° vor OT. Ludwig Apfelbeck behauptet, daß sich bei solchen Ventiltrieben die Steuerzeiten bei hohen Drehzahlen bis zu 15° verstellen. Ich hab mal irgendwo die offiziellen Steuerzeiten für eine 2V-Boxer-BMW gesehen und glaube ihm das.
Für den optimalen Überschneidungspunkt spielt auch die Auslegung von Einlaß- und Auslaßtrakt eine Rolle. Also ausprobieren.Bei Motoren mit nur einer Nockenwelle solltest du die Überschneidung entsprechend einstellen. Hierdurch kannst du den Motor leistungsmäßig an den oberen Rand der Serienstreuung bringen.
In Motoren mit zwei Nockenwellen hast du zusätzlich die Möglichkeit, die Steuerzeiten von Ein- und Auslaß unabhängig voneinander zu verstellen. Das heißt, daß du z.B. den Einlaßschluß später und den Auslaßbeginn früher legst. Dadurch wird ein Leistungsgewinn im oberen Drehzahlbereich erreicht. Die Leistung bei niedrigen Drehzahlen wird sinken. Entsprechend bewirken ein späterer Auslaßbeginn und ein früherer Einlaßschluß eine Verbesserung der Leistung bei niedrigen und einen Verlust bei hohen Drehzahlen.
1-2° Verstellung wirst du schon merken können. 3° Verstellung bemerkt jeder. Mehr als 5° werden nur sehr selten noch etwas bringen, weil durch diese Verstellung immer auch die Höhe der Überschneidung verändert wird. Deswegen ist diese Maßnahme mit Seriennockenwellen nur in engen Grenzen erfolgreich.
Da die Steuerzeiten in Großserienmotoren immer ein Kompromiß zwischen ausreichend Leistung bei niedrigen und genug Leistung bei hohen Drehzahlen sind, läßt sich hiermit aber oft schon erfreulich viel erreichen.
Die meisten Nockenwellen werden über eine Steuerkette und ein auf die Nockenwelle geschraubtes Kettenrad angetrieben, so daß du einfach die Bohrungen in den Kettenrädern mit Langlöchern versehen und darin die Nockenwellen verschieben kannst. Für manche Motoren werden solche Kettenräder schon fertig im Zubehörhandel angeboten. Bei verpressten Zahnrädern müssen diese abgedrückt und versetzt aufgepresst werden. Ich habe bisher nur einen Motor bearbeitet, bei dem die Kettenräder mit den Nocken vergossen waren. Da mußte ich mit den Kettenführungen tricksen.
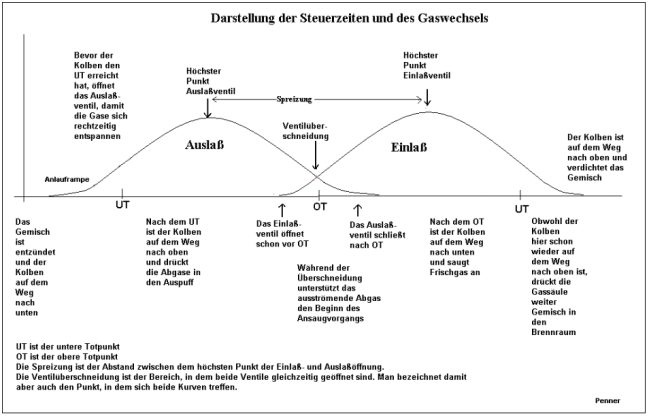
-
-
Hey,
dir scheint die Diskussion zu gefallen, aber du bist nicht angemeldet.
Wenn du ein kostenloses Konto eröffnest merken wir uns deinen Lesefortschritt und bringen dich dorthin zurück. Zudem können wir dich per E-Mail über neue Beiträge informieren. Dadurch verpasst du nichts mehr.
Jetzt anmelden!

